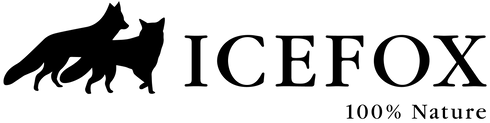Jagdliches Brauchtum: Nur ein alter Hut?
Das jagdliche Brauchtum wird auf den Lehrplänen oft nur noch stiefmütterlich behandelt und muss anderen Fächern weichen. Ich möchte eine Lanze für unsere schöne Jagdkultur brechen!
Unser Brauchtum ist so verdammt vielfältig – von der Jägersprache und den Grundsätzen der Waidgerechtigkeit und jagdlichen Ethik über alte Sitten und Bräuche bis hin zu Bruchzeichen, Jagdsignalen und Jägerliedern reicht dessen Grundgerüst.

Egal, ob einjähriger Lehrgang oder Kompaktkurs. Jäger
wird man erst durch jahrelange, praktische Erfahrung!
Allerdings wird das Thema Jagdkultur meiner Ansicht nach aktuell etwas vernachlässigt, weil der Ausbildungsplan Themen wie Land- und Waldbau, aber vor allem Wildbrethygiene und Waffenhandhabung/-recht für wichtiger erachtet und mangelnde Kenntnisse bei letzteren auch schnell zum k.o. in der Prüfung führen. Das ist einerseits nachvollziehbar, schließlich übernimmt die neue Jägergeneration eine sehr verantwortungsvolle und zudem gesellschaftlich relevante Aufgabe. Andererseits ist Jagd ein altes Handwerk mit eigener Zunftsprache und gewachsenem Brauchtum, das dann leider nur noch rudimentär vermittelt wird. Es beruht künftig eher auf der Freiwilligkeit jedes Einzelnen, ob er sich tiefschürfender damit befasst und grundlegende Dinge aneignet. Mir ist das zu wenig!

Lesen nützt, lesen schützt! Der beste Lehrer aber
ist und bleibt die Praxis, eben "learning by doing"!
Anderes wiederum zu viel: Zu den jüngeren jagdlichen Bräuchen gehört der Jägerschlag. Eine Zeremonie, die nach bestandener Jägerprüfung oder nach dem Erlegen des ersten Stückes durchgeführt wird. Dabei gibt der Jungjäger das Versprechen ab, waidgerecht zu jagen und wird in die Reihen der Jägerschaft aufgenommen. Er erhält mit dem dem Vers „Der erste Schlag soll Dich zum Jäger weih’n. Der zweite Schlag soll Dir die Kraft verleih’n, zu üben stets das Rechte. Der dritte Schlag soll Dich verpflichten, nie auf die Jägerehre zu verzichten“ drei leichte Schläge mit dem Hirschfänger auf die linke Schulter. So angewandt, ist der Jägerschlag eine würdevolle Angelegenheit. Hin und wieder arten einige Jagdbräuche aber auch aus, und es wird mit dem Waidblatt der Allerwerteste versohlt oder der Jungjäger muss Schnaps aus einem ungeputzten Flintenlauf trinken.
In typischen Männerdomänen, wie die Jägerschaft lange eine war, hat sich so manch grober Brauch eingebürgert. Solche Dinge kann man tatsächlich „zum Abschuss“ freigeben und über Bord werfen. Allerdings gibt es meines Erachtens Dinge, die nicht verhandelbar sind!
Eine bildgewaltige Fachsprache
Etwa die Jägersprache; sie ist nicht dafür da, um Geheimnisse auszutauschen, denn viele Zuhörer verstehen oft nur Bahnhof. Es ist eine traditionelle, gewachsene Fachsprache, die in so vielen Beispielen die schöneren Bilder liefert; etwa wenn der Fuchs nicht läuft, sondern schnürt, weil seine Spur im Schnee wie an einer Schnur gezogen aussieht. Das beschossene Stück blutet nicht, sondern schweißt.

Eine über Jahrhunderte gewachsene Zunftsprache,
die es zu pflegen und zu erhalten gilt.
Das in unserer schnelllebigen, oberflächlichen Zeit zu erlernen und zu pflegen, hat nichts mit antiquiert und ewig gestrig zu tun, sondern ist Teil des Jägerseins. Klar kann man auch von ballern, töten, bluten und Kopfschuss sprechen, aber damit eckt man nicht nur bei Menschen, die die Jagd kritisch sehen, an. Man hält sich selbst den Spiegel vor und gibt ein schlechtes Bild ab!
Manche Bruchzeichen haben sich überholt
Der Inbesitznahmebruch und der letzte Bissen sind genauso erhaltenswert, weil sie zum Innehalten auffordern und dem erlegten Stück, es war schließlich mal ein lebendes Tier, Respekt und die letzte Ehre erweisen.

Andere Länder, gleiche Sitten! Auch wenn es nicht der
typische Jägerhut und eine bruchgerechte Baumart ist.
Das gilt selbstredend auch für das Verblasen der Strecke auf einer Gesellschaftsjagd, bei der jede Wildart mit einem eigenen Totsignal geehrt wird. Dass man immer häufiger nur noch ein Stück pro Wildart auf die Strecke legt, hat sich eingebürgert und ist schon aus Sicht der Lebensmittelhygiene zu begrüßen. Anderen Jagdkameraden zeigt man den Jagderfolg mittels Schützen- oder Erlegerbruch an. Bei mir jedoch lieber am Jagdhut als an einer modernen Baseballkappe, aber da sollte man großzügig sein. Andere Zeiten, andere Modesitten! Ob man allerdings noch den Leitbruch erkennen und richtig legen muss, ist im Zeitalter von Handy, Funkgerät & Co. tatsächlich fraglich.
Gemeinsam statt einsam
Nicht zuletzt gehört ein gemeinsames Schüsseltreiben zu einer jeden Gesellschaftsjagd. Das macht doch Jagd aus und hat sie in der Vergangenheit stark gemacht. Nicht der Einzelne galt etwas, sondern die eingeschworene Gemeinschaft von „Handwerkern“, die gemeinsam jagen, nachsuchen, dem erlegten Wild die letzte Ehre erweisen, zerwirken, musizieren, singen und sich beim Schüsseltreiben austauschen. Auch das abgehaltene Jagdgericht, das oft scherzhaft die „Vergehen“ Einzelner vorträgt und ahndet, schweißt doch bei einem Glas Bier zusammen.
Was gibt es Schöneres als nach einem erfolgreichen
Jagdtag die Erlebnisse mit anderen zu teilen?
Eine Tradition, die sich nicht überholt haben sollte. Denn was bringt es, wenn sich jeder nach dem gemeinsamen Erlebnis nach Hause oder aufs Hotelzimmer zurückzieht, um mit dem Handy lieber seine Erlebnisse zu posten anstatt sie in geselliger Runde kund zu tun. So ist auch das Führen eines Jagdtagebuchs immer mehr in Vergessenheit geraten, weil die Selbstdarstellung in den Sozialen Netzwerken so leicht zu realisieren und nur einen Mausklick entfernt ist. Für die Hatz nach „likes“ sollte aber ganz sicher kein Tier sterben müssen. Um dann am darauffolgenden Tag zum nächsten „Gangbang“ (so nannte ein mir bekannter Forstmeister mal die groß angelegten Drückjagd-Events) quer durch die Republik zu reisen.
Öffentliche Ansprache statt doppeltes Abschussentgelt
Was Fehlabschüsse, gefährliche Waffenhandhabung und Ähnliches angeht, wünschte ich mir öfter ein härteres Vorgehen der Jagdleiter. Das doppelte oder dreifache Abschussentgelt für ein nicht freigegebenes Stück wird den einen oder anderen „geldigen“ Jäger nicht davon abhalten, beim nächsten Mal wieder genauso zu handeln. Eine öffentliche Ansprache vor der Jagdgesellschaft mit Schilderung aller Fakten und namentlicher Nennung hat da eine sehr viel disziplinierendere Wirkung. Das hat überhaupt nichts mit öffentlichem Vorführen zu tun, sondern einzig und allein mit Respekt vor dem Wilden und einer waidgerechten Einstellung zum Jagen.

Das Jagdhorn
Es gehört zur Gruppe der Blechblasinstrumente. Ursprünglich wurde es als Signalhorn benutzt und lieferte weder Musikstücke, noch verfolgte es einen künstlerischen Anspruch. Auf große Entfernungen konnte das Horn Befehle und Richtungsanweisungen geben. Schon im frühen Mittelalter (800 - 1000) war es beliebt und heilig, niemand außer dem Träger durfte es berühren oder auf ihm blasen. Das Hifthorn wurde als das wohl älteste Jagdhorn vom einfachen Jäger geblasen, der aus Byzanz stammende Olifant im 11. und 12. Jahrhundert hingegen von Edelleuten. Die Jagdreiter in Frankreich nutzten das Parforcehorn. Der Sauerländer Halbmond als ein sichelförmiges Jagdhorn wird immer noch von den Brackenjägern verwendet. Am meisten verbreitet ist heute jedoch das fünftönige Fürst-Pless-Horn in der Tonart B, das es seit den 1880er Jahren gibt.

Wein, Weib und Gesang
Jägerlieder sind Volkslieder, die die Themen Jagd, Natur, Förster und auch die Wilderei behandeln. Besonders im deutschsprachigen Raum inkl. Österreich und Schweiz werden Jagdlieder zu gesellschaftlichen Anlässen heute noch gesungen, etwa im Rahmen des Schüsseltreibens nach einer Gesellschaftsjagd. Wahre Gassenhauer sind etwa „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“, „Ein Jäger aus Kurpfalz“ oder „Ich bin ein freier Wildbretschütz“. Besonders schön sind auch die Stücke des Jägers und Heidedichters Hermann Löns, die er 1911 im Gedichtband „Der kleine Rosengarten“ veröffentlichte. 1988 vertonte Fritz Jöde 28 Lieder daraus auf einer CD, die von den Künstlern Dirk Schortemeier und Siegfried Behrend eingesungen wurden.

Jagdlicher Aberglaube
Er spielt in unserer aufgeklärten Zeit nach wie vor eine Rolle. Wer zum Beispiel eine gerade Anzahl von Patronen zur Jagd mitnimmt, wird kein Waidmannsheil haben. Das gilt auch für die Mitnahme eines neuen Jagdhutes oder Jagdmessers. Wer ein weißen Stück Wild erlegt, für den sind die Auswirkungen noch drastischer: Er wird innerhalb eines Jahres sterben oder aber mindestens sieben Jahre Jagdpech haben.

Text: Sascha Numßen, numssen@gmx.de, 0036 300 85 1071
Bilder: Sascha Numßen